E – wie Ester
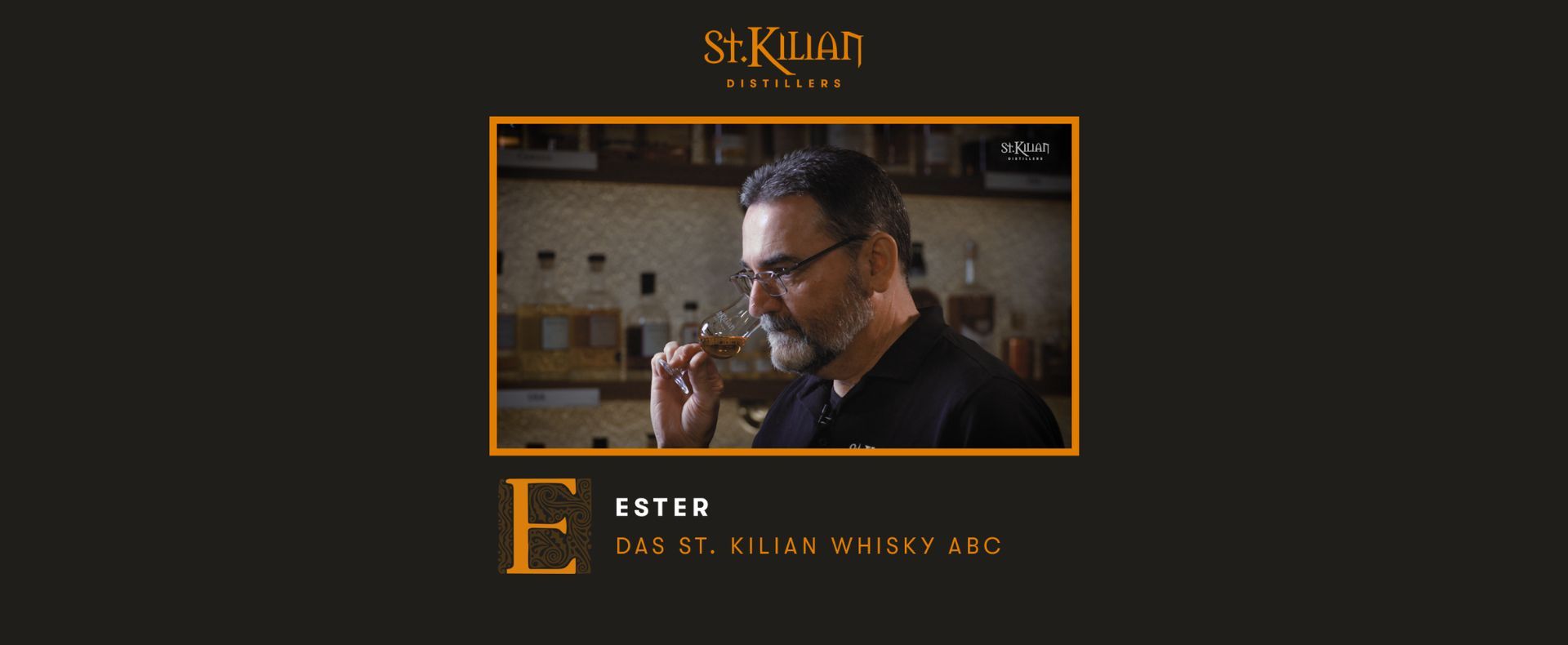
Was sind Ester?
Ester sind chemische Verbindungen, die durch die Reaktion von einer Säure mit einem Alkohol entstehen. Sie stellen in der Chemie eine eigene Verbindungsklasse dar.
Wie funktioniert diese chemische Reaktion zu Estern?
Alkohole reagieren mit organischen Säuren (z. B. Essigsäure, Milchsäure) oder anorganischen Säuren (z. B. Schwefelsäure, Phosphorsäure) in Gegenwart eines Katalysators und unter Abspaltung von Wasser zur einer neuen Verbindungsklasse, die Ester. Diese Reaktion bezeichnet man als Veresterung. Chemisch gesehen handelt es sich hierbei um eine Kondensationsreaktion, da Wasser abgespalten wird. Vereinfacht ausgedrückt, kann man sich einen Ester wie einen Zwei-Komponenten-Klebstoff vorstellen: Komponente 1 (= Alkohol) verbindet sich mit Komponente 2 (= Säure) und härtet unter Verdrängung von Wasser als Gemisch (= Ester) aus.
Wer hat die Veresterung entdeckt?
Der deutsche Chemiker und Nobelpreisträger Hermann Emil Fischer (1852 – 1919) hat Ende des 19. Jahrhunderts erstmals diese Reaktion zwischen Säuren und Alkoholen beschrieben. Sie ist in der Fachliteratur daher auch unter dem Namen „Fischer-Veresterung“ bekannt.
Gibt es bekannte Beispiele für Ester?
Ja. Beispielsweise zählen natürlich vorkommende Fette zu den Estern, da sie aus dem Alkohol Glycerin und verschiedenen organischen Fettsäuren aufgebaut sind. Diese speziellen Ester werden als Triglyceride bezeichnet. Sie werden über die Nahrung aufgenommen und stellen wichtige Energiespeicher im Körper dar.
Welche besonderen Eigenschaften haben Ester?
Zahlreiche Ester weisen ein ausgeprägtes fruchtiges Aroma auf und finden daher als Aromastoffe Verwendung. Solche Ester sind maßgeblich auch für den fruchtigen Geruch und Geschmack eines New Make Spirits bzw. Whiskys verantwortlich.
Kann man Ester im Whisky erkennen?
Ja. Die oftmals fruchtigen Noten im Whisky – wie beispielsweise das Aroma von tropischen Früchten (Ananas, Banane), Beeren (Brombeere, Erdbeere, Himbeere), Pflaumen, Kirschen, in Rum eingelegten Rosinen, Kokos, Zimt, Sternanis oder Minze – sind auf die Existenz von unterschiedlichen Estern zurückzuführen.
Wo werden die Ester bei der Herstellung von Whisky gebildet?
Die Ester entstehen maßgeblich während der alkoholischen Gärung durch die Hefe. Sie werden aber auch während der Destillation sowie der jahrelangen Reifung in Holzfässern aus vorhandenen Alkoholen und Säuren gebildet.
Wie funktioniert die Esterbildung in der Destillerie?
Während der Gärung wandeln die Hefezellen Zucker in Ethanol und Kohlenstoffdioxid um und produzieren dabei eine Vielzahl von Nebenprodukten, darunter auch Ester. Nahezu 100 verschiedene Ester wurden nach der Fermentation in der entstandenen Wash identifiziert. Weitere natürliche Nebenprodukte der Gärung sind verschiedene Alkohole und organische Säuren. Wenn diese während der anschließenden Destillation der Wash in den Pot Stills verdampfen und dabei auf die heiße Kupferoberfläche treffen, können sie miteinander reagieren und auf diese Weise unterschiedliche Ester bilden, die später ins Destillat – dem gesammelten Mittellauf – gelangen.
Welcher Ester wird im Fass maßgeblich gebildet?
Auch während der jahrelangen Reifung im Holzfass entstehen durch chemische Reaktion von Alkoholen mit Säuren verschiedene Ester. Dabei ist der am häufigsten gefundene Ester diejenige Verbindung, die aus dem Alkohol Ethanol und der Säure Essigsäure gebildet wird. Diese Substanz bezeichnet man chemisch als Essigsäureethylester. Dieser Ester wird während der Reifung kontinuierlich im Fass gebildet, wobei die Estermenge im Laufe der Jahre im Fass stetig ansteigt. Dadurch ist die Menge an Essigsäureethylester im Whisky ein Maß für dessen Reifung.
Welche Aromen weist Essigsäureethylester auf?
In geringen Mengen zeigt Essigsäureethylester – also der Ester aus Essigsäure und Ethanol – ein angenehm fruchtiges Aroma, das an grüne Äpfel erinnert. Mit zunehmendem Alter des reifenden Whiskys steigt auch die Menge dieses Esters an und kann einen Konzentrationsbereich erreichen, bei dem ein unangenehmer Klebstoffgeruch entsteht. Das wahrgenommene Aroma eines Esters hängt demnach von dessen Menge, also der Konzentration, ab.
Welche Aromen weisen die Ester im Whisky auf?
Ester können eine breite Palette an Aromen und Geschmacksrichtungen im Whisky erzeugen. Diese reichen von fruchtigen und blumigen Noten bis hin zu würzig-kräuterigen und holzigen Tönen. Exemplarische Beispiele für Ester-Aromen im St. Kilian Whisky sind u. a. Birne, Aprikose, Pfirsich, Apfel, Vanille, Kokosnuss und Minze.
Welche Ester sind dafür verantwortlich?
Für das Birnenaroma ist beispielsweise ein Ester verantwortlich, der aus Essigsäure und Propanol gebildet wird (= Essigsäurepropylester). Der Ester aus Buttersäure und Ethanol (= Buttersäureethylester) weist neben dem Geruch nach Ananas ein ausgeprägtes Pfirsicharoma auf, während der Ester aus Buttersäure und Pentanol (= Buttersäurepentylester) nach Aprikose riecht. Reagiert der Alkohol Pentanol mit Valeriansäure, so weist der entsprechende Ester (Valeriansäurepentylester) ein deutliches Apfelaroma auf. Für den Geruch nach Minze ist ein Ester aus Benzoesäure und Ethanol (= Benzoesäureethylester) verantwortlich.
Von welchen Faktoren hängt die Bildung der Ester bei der Produktion von Whisky ab?
Die genaue Zusammensetzung der Fruchtaromen, die in einem Whisky vorhanden sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Darunter fallen beispielsweise die eingesetzten Rohstoffe, der verwendete Hefestamm, die Dauer und Temperaturführung bei dem Gärungsprozess, der Verlauf der Destillation (Temperatur, Geschwindigkeit, Cut Points), die Lagerungsbedingungen und die Art der verwendeten Fässer, in denen das Destillat heranreift. Jeder Whisky kann daher eine einzigartige Zusammensetzung von Ester-Aromen aufweisen, die zu seinem individuellen und charakteristischen Geruchs- und Geschmacksprofil beitragen.
Benötigt man für die Esterbildung immer zwei separate Reaktionspartner?
Nicht unbedingt. Für die Bildung eines Esters sind zwar immer eine Säure und ein Alkohol notwendig. Das müssen aber nicht zwangsläufig zwei Moleküle sein. Denn es gibt auch chemische Verbindungen, die beide Gruppen – also die Säure- und die Alkoholgruppe – in ein und demselben Molekül besitzen. Eben an verschiedenen Stellen im Molekül. Unter geeigneten Bedingungen können die Säure- und die Alkoholgruppe in diesem Molekül miteinander reagieren. Das Ergebnis ist dann ein ringförmiger Ester, den man in der Chemie als Lacton bezeichnet. Solche Lactone gibt es tatsächlich und sie kommen beispielsweise in der Natur im Eichenholz vor. Amerikanische Weißeiche enthält viel von diesen speziellen Lactonen, die ein Aroma und Geschmack von Kokos aufweisen. Diese Lactone werden in der Fachliteratur als Whisky-Lactone oder Quercus-Lactone bezeichnet.